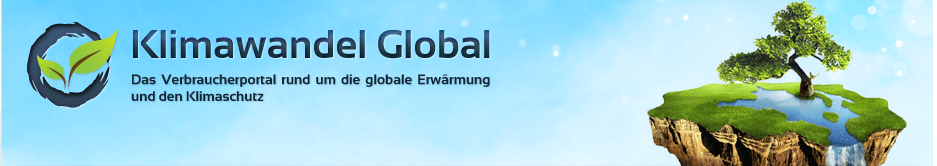Der Klimawandel ist ein globales Problem und erfordert insoweit globale Lösungen. Das apokalyptische Bedrohungsszenario und die globale Dimension teilt der Klimawandel mit einer anderen Zeiterscheinung, dem Terrorismus. Beides verweist zurück auf dem Menschen, auf das von ihm verursachte malum morale, beides wird entsprechend im Rahmen einer neuen politischen Ethik zu lösen versucht und beides droht, als rhetorische Figur im Diskurs um Sicherheit, also um Einschränkungsmöglichkeiten von Freiheit und Freizügigkeit, zu eine Art „Argumentationsjoker“ zu werden, den man immer ziehen kann, wenn es darum geht, unpopuläre Maßnahmen zu rechtfertigen und der alles andere aussticht; zu groß ist die Aufgabe der Befriedung der Welt sowie die, dafür zu sorgen, dass künftige Menschheitsgenerationen nicht nur in Frieden und gesicherter Freiheit leben können, sondern überhaupt überleben.
Ist dies im Zusammenhang mit dem Terrorismus als malum morale schlechthin unstreitig, so bedarf es bei dem in unterschiedlichen Ausprägungen von malum physicum (also etwa Hochwasser, aber auch das Gegenteil: Dürre) sich manifestierenden Klimawandel einer Rechtfertigung für die Zuschreibung menschlicher Schuld aus moralisch relevanten Verfehlungen. Diese wurde und wird durch Studien geleistet, welche die anthropogenen Ursachen der Erderwärmung über den vermehrten CO2-Ausstoß belegen (IPCC 2007).
Terrorismus und Klimawandel weisen aber nicht nur ursächlich, also gewissermaßen hinsichtlich der Schuldfrage, Parallelen auf, sondern es handelt sich insbesondere deswegen um sich parallel entwickelnde Menschheitsprobleme, weil sie die Menschheit hinsichtlich ihrer Folgen existenziell betreffen, und zwar als Fragen globaler Sicherheit. Beim Terrorismus ist das evident, da Sicherheitsinteressen eine Rolle spielen, beim Klimawandel muss man wieder etwas genauer hinschauen.
Dies taten John Podesta und Peter Ogden in ihrem Artikel The Security Implications of Climate Change (2008). Sie kommen darin, nach regional fokussierten Analysen zu Afrika, Südasien und China sowie zur Rolle von UNO, EU und USA, die sie im Rahmen der Klimawandelfolgen geopolitisch in der Pflicht sehen, zu einem differenzierten Urteil: Zwar stünden keine durch Dürren provozierte „Wasser-Kriege“ unmittelbar bevor, wie häufig prognostiziert, aber dennoch sei der Klimawandel eine Frage der Sicherheit, weil sich durch dessen Folgen (also Naturkatastrophen und in weiterer Folge Knappheit und Seuchen) zum einen das Problem des Staatszerfalls in verschärfter Form stelle, was zum Souveränitäts- und damit Sicherheitsvakuum vor Ort führe (die Autoren nennen Ost-Afrika und Nigeria), zum anderen dieses Problem über Flüchtlingsströme nach Europa getragen werde, wo sich im Zuge einer mittelbaren Betroffenheit nicht nur die demographische Situation und die Sozialstruktur ändere, sondern sich gleichfalls die Sicherheitslage verschlechtere; die Autoren verweisen auf die wachsende Gefahr ethnisch und religiös motivierter Konflikte.
Migration, unerheblich ob Kriegs-, Wirtschafts- oder Umwelt-Migration betrifft Drittstaaten und stellt einen „Angriff“ dar, ähnlich wie dies bei Terroranschlägen und – klassischerweise – beim Krieg der Fall ist, einen „Angriff“ der „Selbstverteidigung“ völkerrechtlicht erlaubt. Dieser Zusammenhang soll nicht deshalb völkerrechtsdogmatisch exponiert werden, um militärische Grenzsicherungen zu begründen, sondern um zu zeigen, dass es möglich ist, auf der Grundlage von Kapitel VII der UN-Charta einzuschreiten, wenn in einem Staat Menschenrechte verletzt werden und dies eben nicht unter dem Schutz der Souveränitätsgarantie als „innere Angelegenheit“ durchgehen soll.
Dazu führt der Völkerrechtler Doehring aus, dass Menschenrechtsverletzungen in Staat A i. d. R. Flüchtlingsströme von Staat A nach Staat B auslösen. Deshalb ist durch die Menschenrechtsverletzungen ein anderer Staat (nämlich B) negativ betroffen, was wie ein „Angriff“ des Staates A auf den Staat B zu werten sei. Gleiches gilt für Bürgerkriege, die ebenfalls zunächst „innere Angelegenheiten“ sind, solange nicht andere Staaten beeinträchtigt werden, was jedoch auch in diesen Fällen regelmäßig durch die Flüchtlinge der Fall ist. Insoweit kann auch der Bürgerkrieg als „Angriffskrieg“ gewertet werden und die UNO darf nach Maßgabe von Kapitel VII der Charta Zwangsmaßnahmen ergreifen (Doehring 2004: 202 f.). Gleiches gilt eben auch für die Migration, die im Zuge des Klimawandels zu erwarten ist.
Podesta / Ogden scheinen der Meinung zu sein, dass in der Sicherheitsfrage zwar de jure die VN zuständig, de facto aber die USA (und ihr Militärapparat) gefordert sind, weil sie den Betroffenen als erster Ansprechpartner gelten: „Although some of the emergencies created or worsened by climate change may ultimately be managed by the UN, nations will look to the United States as a first responder in the immediate aftermath of a major natural disaster or humanitarian emergency.“ (2008: 132). Interessant ist dabei die Tatsache (und sie offenbart eine gewisse Ironie), dass die USA, die präventiv kaum engagiert sind, reaktiv in die Pflicht genommen werden und dass sich zudem die Bush-Doktrin des Anti-Terror-Kriegs („If the UN will not act, the U.S. will.“) als normative Forderung im Rahmen der Klimawandel-Problematik positiv wenden lässt: „Wenn die VN nicht können, dann sollen die USA.“
Bibliographie:
Doehring, Karl (2004): Völkerrecht. Heidelberg.
IPCC (2007): Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm, letzter Zugriff: 7.6.2008.
Podesta, John / Ogden, Peter (2008): „The Security Implications of Climate Change“. In: The Washington Quarterly, 31, 1, 115-138.
Zum Autor:
Josef Bordat, Dr. phil., Dipl.-Ing., M.A. – Mitglied des Katastrophennetzwerks „KatNet – Netzwerk zwischen Forschung und Praxis“ mit dem Arbeitsschwerpunkt „Philosophische und theologische Aspekte der Katastrophenthematik (naturphilosophische Deutungen, ethische Implikationen, moraltheologische Rezeption, Theodizeefrage) unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels“. Veröffentlichung: „Ethik in Zeiten des Klimawandels“. In: Voss, M. (Hrsg.) (2008): Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Wiesbaden. (i. V.)