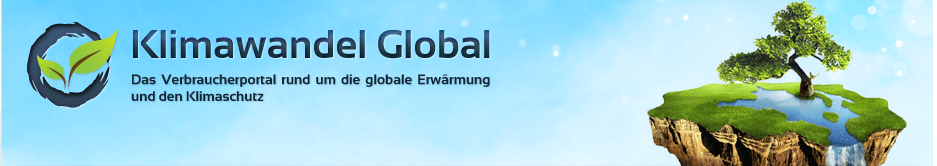Wir kommen zu Teil Zwei unseres Specials über CO2 Gebäudesanierung. In diesem Teil gehen wir kurz auf die Möglichkeiten zur thermischen Sanierung von Altbauten ein.
Bis zu 50 Prozent der Heizenergie kann durch schlecht gedämmte Wände, Dächer und Fenster verloren gehen. Wer effektiv dämmt, spart nicht nur Geld sondern schont auch die Umwelt durch wesentlich weniger CO2-Emissionen. Durch Nutzung einer modernen da effizienteren Heizung können auf Dauer weitere Einsparungen realisiert werden.
Je nach Alter des Gebäudes sind die Schwachstellen des Hauses unterschiedlich. Mittels einer thermografischen Aufnahme (Wärmebild) können Energieverlustpunkte am Haus sichtbar gemacht werden. Dann können die in Frage kommenden Stellen gezielt gedämmt werden.
Folgende Dämmungsmaßnahmen werden bei der thermischen Sanierung von Altbauten durchgeführt:
-
- Stärkere Dämmung von Dach und Geschossdecken: Bei unzureichender Dämmung können 10 bis 20 Prozent Energieverluste entstehen
-
- Aussenwanddämmung: Alte Fassaden verursachen einen Wärmeverlust von bis zu 25%
-
- Dämmung der Kellerdecke: Bis zu 10 Prozent der Wärme geht durch den Fußboden verloren
-
- Erneuerung der Fenster/Türen: Alte Fenster sind oft die größten Schwachstellen im Haus. Die Beseitigung von Undichtheiten und der Einbau von modernen Fenstern sparen am meisten Energie
-
- Erreichen von Winddichtheit: Vom kalten Wind durchblasene Bauteile verringern die Dämmwirkung und erhöhen die Heizkosten
-
- Erkennen und Dämmen von Wärmebrücken wie Balkonplatten, Fenstersimmse, etc.
Soviel zur Wärmedämmung. Eine weitere Senkung der Energiekosten kann durch Erneuerung bestehender Heizanlagen erreicht werden. Dabei kommten vermehrt zum Einsatz:
-
- Brennwertkessel, Wärmepumpe, Biomassekessel (z.B. Holzpelletsheizungen) aber auch die Nutzung von Fernwärme
- Einbau thermischer Solaranlagen zur Unterstützung der Heizung