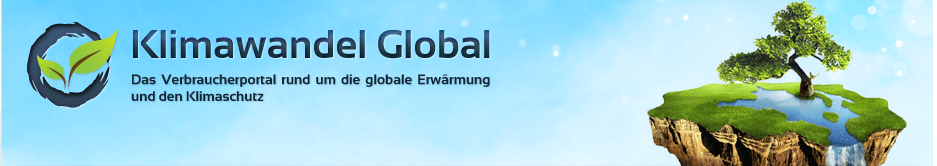220.000 Tote und Sachschäden in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar machen das abgelaufene Jahr 2008 zu einem der schlimmsten Katastrophenjahre der Geschichte. Wie die Münchener Rück mitteilte, habe es nur 2005 (Folgen des Tsunami in Südostasien; Hurrikan „Katrina“ in den USA) sowie 1995 (Erdbeben in Kobe, Japan) eine höhere Schadenssumme gegeben. Besonders der Sturm „Nargis“ in Birma, bei dem mehr als 135.000 Menschen ums Leben kamen, und das Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan, das einen Schaden von 85 Mrd. US-Dollar anrichtete, werden als Katastrophen des Jahres 2008 in trauriger Erinnerung bleiben. Deutlich wird, dass bei Naturkatastrophen in Entwicklungsländern insbesondere Menschen zu Schaden kommen, während in den Industrienationen vor allem Sachgüter betroffen sind. Insgesamt ergibt sich aus der Bilanz auch eine sehr ungleiche globale Verteilung von Naturkatastrophen: Menschen in ärmeren Weltregionen sind häufiger und stärker betroffen als Menschen in wohlhabenderen Gegenden der Erde. Die besondere Stärke der Betroffenheit hängt mit den nur in sehr geringem Maße getroffenen Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen zusammen, deren Finanzierung, etwa im Rahmen von Bauprojekten, oft nicht möglich ist, die erhöhte Häufigkeit hat geologische, meteorologische und klimatische Ursachen.
Die für Naturkatastrophen immer häufiger ursächlichen Wetterextreme stellt die Münchener Rück unterdessen in einen Zusammenhang mit den globalen klimatischen Veränderungen. Der Klimawandel trage mit großer Wahrscheinlichkeit dazu bei, den beobachteten Trend zu mehr Schadensereignissen und höheren Schadenssummen zu beschleunigen, so Torsten Jeworrek, Vorstandsmitglied der weltweit größten Rückversicherung. Daher dürfe die Wirtschaftskrise nicht dazu führen, den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren. Die Münchener Rück, bei der sich Versicherungsgesellschaften ihrerseits versichern können, berücksichtigt im Rahmen ihrer Risikoanalyse zu den von ihr angebotenen Rückversicherungsmodellen seit einigen Jahren den Klimawandel als bedeutenden Faktor.
Zum Autor:
Josef Bordat, Dr. phil., Dipl.-Ing., M.A. – Mitglied des Katastrophennetzwerks „KatNet – Netzwerk zwischen Forschung und Praxis“ mit dem Arbeitsschwerpunkt „Philosophische und theologische Aspekte der Katastrophenthematik (naturphilosophische Deutungen, ethische Implikationen, moraltheologische Rezeption, Theodizeefrage) unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels“. Veröffentlichung: „Ethik in Zeiten des Klimawandels“. In: Voss, M. (Hrsg.) (2008): Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Wiesbaden. (i. V.)