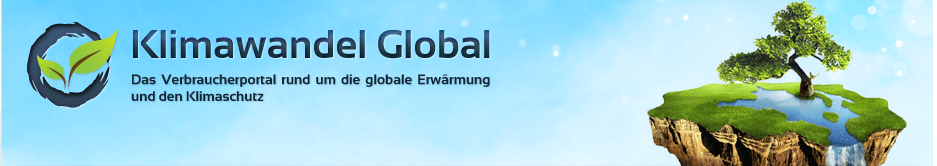Ohne Sonne ist kein Leben auf der Erde möglich. Und doch könnte die Sonne mit Verantwortlich dafür sein, dass das Leben auf unserem blauen Planeten in Zukunft um einiges härter wird. Derzeit beobachten Wissenschafter nämlich, dass sich das Magnetfeld der Erde umkehrt. Das an sich ist noch kein Grund zur Sorge, ist es doch eigentlich normal. Doch diesmal könnten bei diesem Prozess sogar vier Pole entstehen, was laut japanischen Wissenschaftlern Ursache für die Kleine Eiszeit gewesen sein könnte.
Bringt die Sonne also die nächste Eiszeit?
Das Magnetfeld der Sonne weist normalerweise eine Dipol-Struktur auf, mit einem Nord- und einem Südpol. Bei jedem Sonnenzyklus, ungefähr alle 11 Jahre, vertauschen sich die Pole dann symmetrisch. Der Nord- wird zu einem Südpol. Aktuell jedoch verläuft diese Entwicklung beim sogenannten Schwab-Zyklus nicht wie bisher. Anstatt von zwei Magnetpolen bildet sich scheinbar gerade eine Quadrupolstruktur.
Forscher des Nationalobservatorium Japan untersuchen seit 2008 mit der Forschungssonde „Hinode“ in monatlichen Abständen die magnetischen Pole der Sonne. Die Messungen haben nun aber zu ungewöhnlichen Ergebnissen geführt. Demnach scheint der magnetische Fluss, der ein Maß für die Stärke eines Magnetfeldes ist, in der Nordpol Region zunehmend abnimmt.
Polumkehr für Mai 2013 erwartet
Den Abschluss des aktuellen Zyklus erwartet man eigentlich für Mai 2013. Doch wie es nun aussieht, könnte das schon wesentlich früher der Fall sein. Wie Forscher der Hindode-Sonde feststellen, nähert sich der magnetische Fluss in der Nordpol-Region der Sonne schon jetzt dem Wert null an. Die Feldumkehr dürfte demnach in etwa einem Monat vollendet sein. Der magnetische Fluss in der Südpol-Region bleibt im Vergleich jedoch sehr stabil und hält seine Polarität aufrecht. Derzeit herrscht also eine Ungleichheit zwischen Nord- und Südpol vor.
Und es sind nicht nur die japanischen Wissenschaftler, die zu diesem Ergebnis kommen, sondern auch Forscher der US-Raumfahrtbehörde Nasa.
Abnehmende Sonnenaktivität und Kleine Eiszeit
Die Japaner schließen aus diesen Entwicklungen, dass sich wegen der asymmetrischen Polumkehr demnächst weiter Pole bilden könnten. Eine Quadrupol-Struktur könnte demnach Auswirkungen auf das Magnetfeld haben und es abschwächen, und die Sonnenaktivität würde auch abnehmen. Und damit, so fürchten die japanischen Wissenschafter, könnte die Sonne wieder in eine Zustand verfallen, wie schon während der Kleinen Eiszeit. Viele Forscher gehen davon aus, dass eine geringe Sonnenaktivität Ursache für diese Eis-Periode gewesen sein könnte.
Nicht jeder stimmt den Forschungs-Ergebnissen der Japaner jedoch zu. Die Sonne verhält sich für ihre Verhältnisse ganz normal und kleine Abweichungen kann es immer mal wieder geben. Genauere Prognosen lassen sich nur schwer erstellen, da die Sonne und ihre Aktivitäten noch nicht ausreichend erforscht sind.